Das Nichts und das Etwas
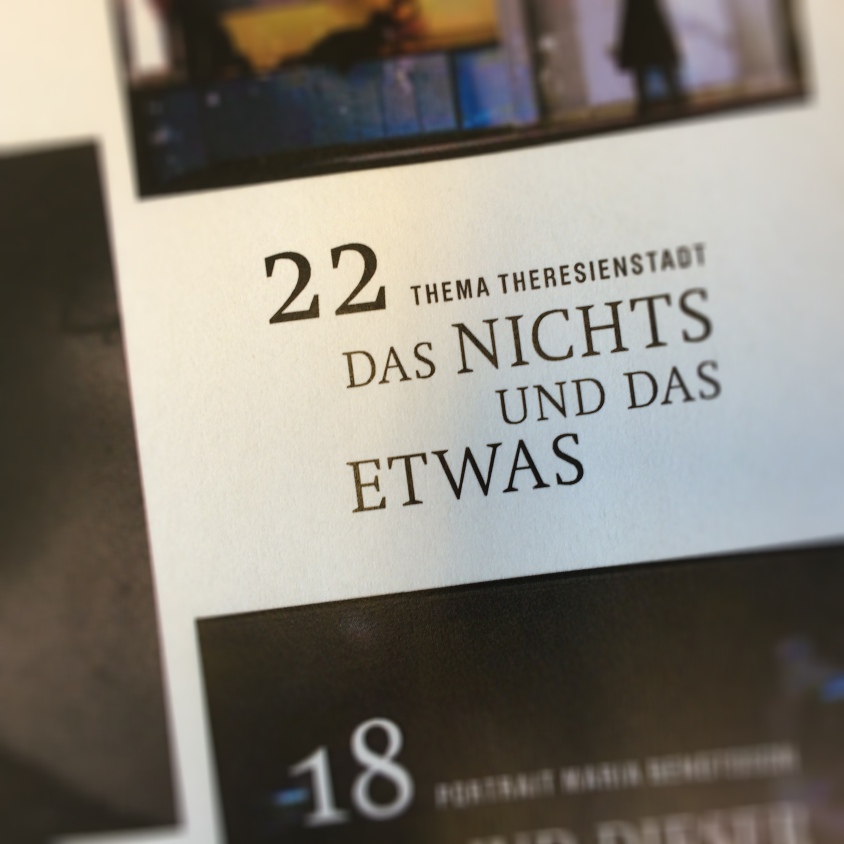
Hier lest ihr einen Auszug aus der ersten Ausgabe des heute erschienenen Magazins: Der Chefredakteur Jürgen Otten über die ambivalente Rolle der (klingenden) Kunst im Konzentrationslager Theresienstadt.
»So lange wir nicht auch das Unrecht, welches uns geschieht und uns die kühlen
brennenden Thränen auspresst , für Rechte halten, sind wir noch in der dicksten
Finsternis, ohne Dämmerung.«
Rahel Levin-Varnhagen, 1799
Nachts, wenn die Kinder schliefen, griff Ilse Weber zur Gitarre. Und sie tat das, was sie den ganzen Tag
nicht hatte tun können als Schwester auf der Krankenstation des Konzentrationslagers Theresienstadt.
Sie sang. Doch nicht irgendeine vertraute Melodie. Ilse Weber sang Lieder, deren Texte sie selbst gedichtet und dessen Klänge sie selbst erfunden hatte, Lieder, die davon erzählten, was um sie herum und
in ihr selbst vorging, Lieder, die zum Berührendsten zählen, was in Theresienstadt zu Papier gebracht
wurde, weil sie in knapp gefassten Versen die tiefe Verzweiflung ihrer Protagonistin schildern, Lieder
wie dieses: »Ich wandre durch Theresienstadt, / das Herz so schwer wie Blei. / Bis jäh mein Weg ein Ende
hat, / dort knapp an der Bastei.«
Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager ist reich an Grausamkeiten jeglicher
Coleur. Ihren zynischsten Ausdruck aber erfuhr diese Geschichte in Theresienstadt. Menschlichabgründige
Bosheit wurde hier zum existentiellen Experiment, der Absolutismus einer heuchlerisch
gefälschten Wirklichkeit zum determinierenden systemischen Faktor. Theresienstadt bedeutete den
harten Aufprall des jüdischen Individuums auf die Totalität der Vernichtungsdiktatur, wobei es von diesem
Aufprall zwei Geschichten gab: eine wahre und eine falsche. Die falsche wurde von Hitlers Schergen
nach allen Regeln der Kunst und absichtsvoll als Illusionstheater inszeniert. In seiner pervertiertesten
Form geschah dies in jenem von der SS in Auftrag gegebenen Dokumentarfilm des jüdischen [1944
in Auschwitz ermordeten] Schauspielers, Regisseurs und Kabarettisten Kurt Gerron, der irrigerweise
unter dem Titel Der Führer schenkt den Juden e ine Stadt kursierte, in Gänze gleichwohl nie im Kino
zu sehen war. Theresienstadt erscheint darin als »Paradiesghetto« für ehemalige jüdische Patrioten, die
dort einen geruhsamen Lebensabend verbringen, sanft umgürtet von Kunst und Kultur und anderen
Vergnügungen. Theresienstadt als Hollywood-Traumfabrik der SS-Opfer.
Dem Traum stand die wahre Geschichte gegenüber wie eine zweite, wahnhaft verworfene Realität.
In dieser Realität war Freiheit gleichbedeutend mit dem Tod oder, in negativer Dialektik, der Tod
eine beinahe Kirilowsche Form der Freiheit — und das Leben im KZ nur Nichtswürdigkeit, Demütigung,
Deprivation. Der Zynismus der Herrschenden wollte es so. Er spiegelte den Menschen im Lager eine
Normalität der Gegenwart vor, wusste aber doch zu jedem Zeitpunkt, dass dieser Gegenwart eine Zukunft
folgen würde, die Auschwitz hieß.
Und doch: Die Menschen in Theresienstadt hofften. Sehnsucht war ihr einziges Prinzip. Sehnsucht
nach einem Deus ex machina, der das Grauen beenden und sie befreien würde. Nie war der
Satz von der Hoffnung, die zuletzt stirbt, gültiger als in Theresienstadt, Jurek Becker hat das in seinem
faszinierend tristen Roman Jakob der Lügner in triftige Worte gesetzt. Jakob, der Titelheld des
Romans, lügt ja nicht, weil er ein schlechter Mensch wäre. Nein. Er lügt, um die Hoffnung sämtlicher
Lagerinsassen am Leben zu erhalten. Deswegen ist etwas dran an der These des Historikers H. G. Adler,
Theresienstadt sei auch eine Geschichte der Selbstbehauptung des Etwas in einer Negation seiner selbst
gewesen. Denn das Etwas habe sich, so Adler, in einem für gewöhnlich nicht erforderlichen Maße
Werte verleihen müssen. Je mehr diese Werte verneint worden seien, desto sorgfältiger habe man nach
ihnen getrachtet. Und genau aus diesem [zureichenden] Grund entstand in Theresienstadt Kunst. Deswegen
wurden Gedichte und Theaterstücke und Lieder und Symphonien und sogar Opern geschrieben
und aufgeführt. Zugegeben, es war fürwahr ein schauerlicher Karneval, der zudem fast niemandem der
Beteiligten ganz zu Bewusstsein kam, dieses Ausgestellt-Werden von Kunst kurz vor und in Gedanken
an Auschwitz. Aber es war eben auch die einzige Chance für die Kunstschaffenden, ihrem ausweglosen
Leben einen wie auch immer gearteten Sinn zu verleihen; einen Sinn, den das Leben an sich nicht mehr
besaß. Und so widerwärtig war diese Welt in jenen Tagen beschaffen, dass es sogar einen feinen Unterschied zwischen den schicksalhaft miteinander verknüpften Konzentrationslagern gab: In Auschwitz
herrschte bloße Verzweiflung, und mochte sich die Seele selbst dort noch durch Verwandlungszauber
in holde Truggefilde flüchten, so war eine Täuschung der Welt schlechterdings unmöglich. Anders in
Theresienstadt. Hier konnte die Illusion wild wuchern, hier überstrahlte die von angstvollen Gefühlen
nur gering gedämpfte Hoffnung alles, was sich unter undurchsichtigem Nebel verbarg. Und hier trat
buchstäblich hervor, was Nietzsche einst formuliert hatte: Wir haben die Kunst, um nicht an der Wirklichkeit
zugrunde zu gehen.
Oder wie dichtete ehedem Eichendorff in seiner Mondnacht: »Und meine Seele spannte / Weit
ihre Flügel aus.« Musste es auch tun, als Kultur in der Barbarei, um nicht zu verlöschen. Musste sich ausleben, um den physischen wie psychischen Deformationen, denen jeder KZ-Insasse in ausgesetzt war,
etwas entgegensetzen zu können. Wie zum Beleg stürzten sich die Theresienstädter Künstler mit doppeltem
Eifer in ihre Arbeit, wenn wieder einmal ein Transport nach Auschwitz abgegangen war — so,
als sei nichts Außergewöhnliches geschehen. Das Außergewöhnliche aber war für sie, weit mehr als in
ihrer vormaligen bürgerlichen Existenz, conditiosine qua non ihres Daseins im Warte- und Sterbensraum.
Denn um sich von dieser prognostizierten und immer wieder brutal einbrechenden Wirklichkeit
abzuschotten, war es — und darin liegt eines der menschenverachtendsten Paradoxa von Theresienstadt
— geradezu lebensnotwendig, in den Raum der Kunst zu flüchten.
Die Bedingungen dieser Kunst — die im offiziellen Sprachgebrauch mit dem Euphemismus »Freizeitgestaltung« beschrieben wurde — waren bescheiden. Musikinstrumente gab es wenige, und diese wenigen waren in einem wenig rühmlichen Zustand [auch hier wieder der real existierende Zynismus: Sie stammten meist aus jüdischem, durch die Nazis enteigneten Besitz]. Die Künstler nahmen dennoch, was sie kriegen konnten. Einen stark beschädigten Flügel etwa, dem die Beine fehlten, schaffte man in den Turnsaal der alten Schule L 417, stellte ihn auf Holzblöcke, richtete ihn notdürftig her, und dann spielten Professor Bernhard Kaff oder Gideon Klein darauf Werke der deutschen Komponisten Beethoven, Bach und Brahms. Dass Musik auch zum subversiven Element taugte, zeigte sich in jenen Konzertabenden, die mehr oder minder illegal stattfanden. Man traf sich zum Musizieren in unbewohnten Räumen, mal in einer Kanzlei des Gebäudeältesten, einmal sogar in einen Kartoffelschälraum. Das trug nicht selten das Gepräge des Surrealen. Geradezu gespenstisch aber muss die Atmosphäre im »Kaffeehaus« gewesen sein. Dichtgedrängt saßen dort ausgemergelte Gestalten beieinander, vom Lagerleben gezeichnet und doch zum Teil mit leuchtenden Augen, wenn das kleine Orchester anfing zu spielen.
Es ist beeindruckend und erschütternd zugleich, welche Werke jüdischer Komponisten von Rang unter diesen Umständen in Theresienstadt entstanden und / oder gespielt wurden, allen voran die Opern Der Kaiser von Atlantis von Victor Ullmann, Der gläserne Berg von Franz Eugen Klein und Hans Krásas Kinderoper Brundibar, die Theresienstädter Symphonie von Carlo Taube, ferner Kammermusik der Komponisten Simon Laks, Pavel Haas, Józef Koffler, Sigmund Schul und Gideon Klein. Damit war die Musik aber noch nicht zu Ende. Sowohl Smetanas Verkaufte Braut als auch Opern von Mozart, Puccini und Bizet und sogar Verdis Requiem erlebten in Theresienstadt konzertante [meist vom Klavier begleitete] Aufführungen. Und dann war da noch ein Werk, das erklang, ohne dass jemand dagegen revoltiert hätte. Johann Straußens Operette Die F ledermaus. Es gibt darin eine heiter-unbeschwerte Melodie, der Tenor Alfred stimmt sie an, in der mit wenigen Worten die ganze zynische Tragik Theresienstadts beschrieben ist: »Glücklich ist, wer vergisst, / was doch nicht zu ändern ist.« Auschwitz aber lässt sich nicht, niemals vergessen. Fast alle Künstler aus dem »Paradiesghetto«, unter ihnen auch der 14-jährige Honza Treichlinger, der den Brundibar verkörpert hatte, wurden dorthin verschleppt wie Vieh und vergast. So auch Ilse Weber, die Dichterin. Als bekannt wurde, dass die Kinder ihrer Krankenstation deportiert würden, ging sie freiwillig mit ihnen in den Tod. Häftlinge bezeugten, sie habe in der Gaskammer gemeinsam mit den Kindern deren Lieblingslied Wiegala gesungen.
Diesen Beitrag findet ihr auch in Staatsoper – Das Magazin No. 1, welches am 30. August 2014 erscheint.

2 Kommentare
schrieb am 03.09.2014 um 14:36 Uhr.
Leider enthält dieser interessante Artikel einige bedauerliche Fehler.
1) Konzerte waren ab Ende 1942 in Theresienstadt nicht mehr „mehr oder weniger illegal“, sondern wurden offiziell von der Jüdischen Selbstverwaltung organisiert. Sie fanden kaum je in dunklen Löchern, sondern meist im Rathaussaal statt. Der in Theresienstadt inhaftierte Geiger Thomas Mandl bezeugte, dass die Ghettoinsassen „sich in einer ungleich freieren Atmosphäre des gesamten Kulturlebens bewegen konnten als die Menschen, die in Deutschland 1933 bis 1945 in ‚Freiheit‘ leben durften“. (abgedruckt im Band mit Viktor Ullmanns Theresienstädter Musikkritiken)
2) Ullmanns Oper „Der Kaiser von Atlantis“ entstand zwar in Theresienstadt, wurde dort aber nicht gespielt. (Genaueres dazu in der Ullmann-Biographie von Ingo Schultz, erschienen bei Bärenreiter)
3) Die Komponisten Simon Laks und Józef Koffler haben nichts mit Theresienstadt zu tun.
4) Theresienstadt unterstand der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Prag und gehörte nicht zum System der Konzentrationslager. Die Bezeichnung Konzentrationslager ist deshalb irreführend.
schrieb am 04.09.2014 um 18:01 Uhr.
Lieber Herr Dümling, herzlichen Dank für Ihre Hinweise und fachlich wichtigen Ergänzungen! Es ist eine Bereicherung, dass Sie als Fachmann Ihren Kommentar zu diesem Essay auf unserem Blog veröffentlicht haben. Da wir die Blickrichtung des Essays grundsätzlich richtig finden, werden wir von Änderungen absehen. Mit Dank und besten Grüßen, Ihr Redaktionsteam